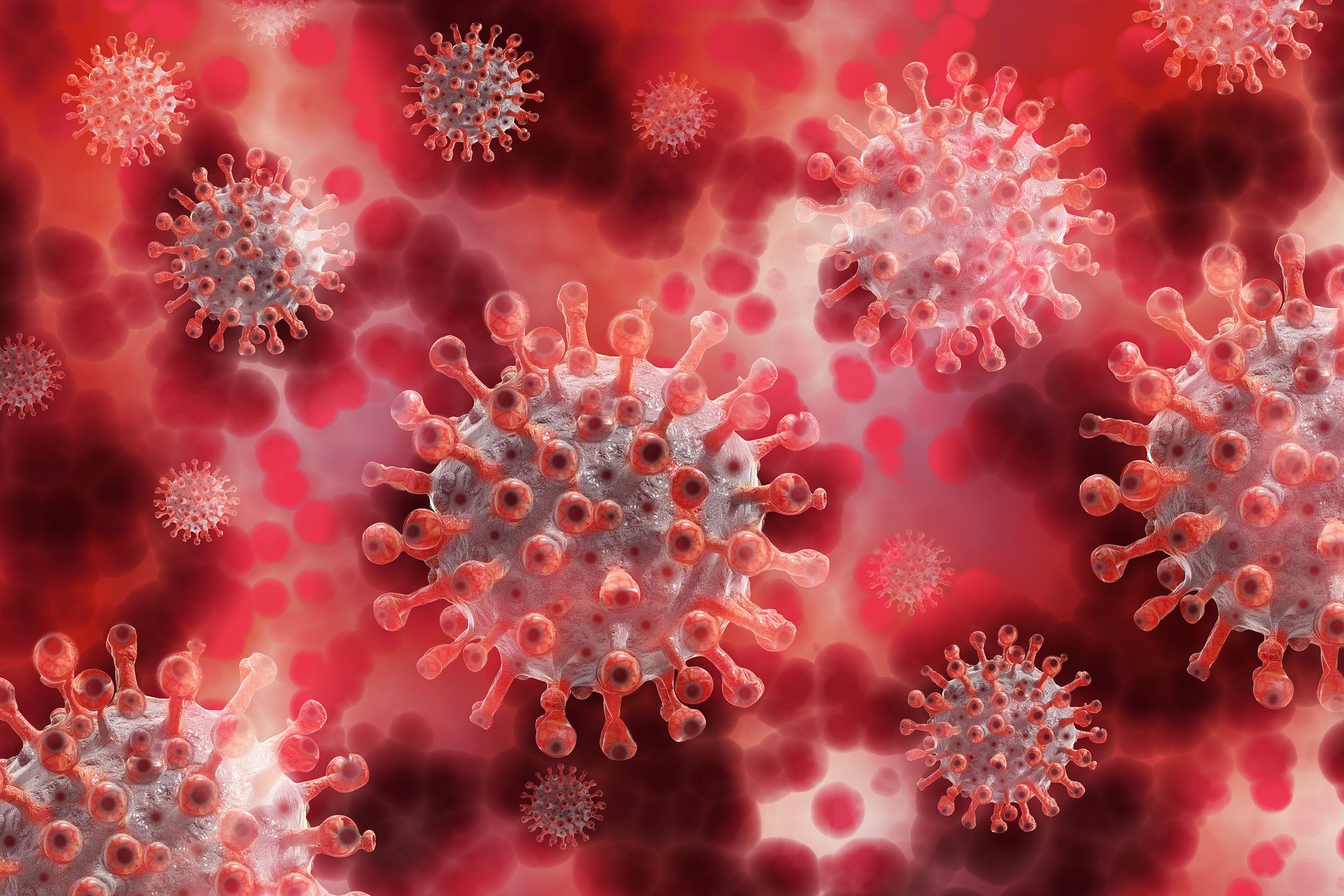(Bild: Gerd Altmann/Pixabay)
Wie lange wird uns das Coronavirus noch begleiten? Das weiss zurzeit niemand. Ein Blick auf die Wissenschaft und den Stand der Dinge im Kampf gegen Corona.
Von David Frische
Die Corona-Pandemie ist erst vorbei, wenn die Wissenschaft einen Wirkstoff gegen das Virus gefunden hat. So lange muss die Weltbevölkerung durchhalten. Mit Einschränkungen leben. Normalität wird es noch länger keine geben, das steht fest.
Internationale Pharmakonzerne und Forschungseinrichtungen arbeiten aber mit Hochdruck daran, eine Lösung im Labor zu finden. Wer besiegt das Coronavirus? Und wie schnell? Eine Auslegeordnung.
Medikamente – bislang eine Enttäuschung
Der Basler Pharma-Riese Novartis versprühte die Hoffnung, Corona mit einem Malaria-Medikament bekämpfen zu können. Der Konzern gewann die USA für sein Vorhaben und schnell begann man, den Wirkstoff Hydroxychloroquin an US-Patienten zu testen.
Wie sich diese Woche nun herausstellte, ohne Erfolg. Erste Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass das Malaria-Mittel keine Waffe gegen Covid-19 ist, im Gegenteil: Laut der Studie ist die Sterberate bei Patienten, die Hydroxychloroquin verabreicht erhielten, deutlich höher als bei der Vergleichsgruppe. Ein Rückschlag für Novartis und die US-Regierung, welche die Untersuchung finanzierte.

Bislang erwies sich noch kein Medikament als wirksam gegen Covid-19. (Bild: Pexels/Pixabay)
Die Hoffnung, dass Hydroxychloroquin aber doch hilft, besteht aber noch. Viele Mediziner vertreten weiterhin die Überzeugung, dass der Wirkstoff Covid-19 bekämpfen kann. Weitere Tests werden darüber Aufschluss geben, sie sind momentan noch im Gang. Deshalb ist Hydroxychloroquin momentan auf der ganzen Welt Mangelware.
Der Wirkstoff wird aber auch in der Therapie anderer Leiden eingesetzt, beispielsweise bei rheumatologischen Erkrankungen. Deshalb hat die Universität Basel damit begonnen, Tabletten mit Hydroxychloroquin selbst herzustellen, wie sie am Donnerstag mitteilte. Einerseits für die Menschen, die das Mittel sowieso brauchen, andererseits für Covid-19-Kranke, sollte das Mittel denn zum Erfolg führen. Aus dem momentan vorhandenen Wirkstoff können Dosen für 20’000 Patienten hergestellt werden, wie die Uni kommunizierte.
Klar ist hingegen, dass Antibiotika gegen das Coronavirus nutzlos sind. Sie wirken nur gegen bakterielle Erreger und bieten somit keinen Ausweg aus der aktuellen Pandemie.
Antikörper-Tests – eine wertvolle Hilfe
Mit Roche schickt der Pharmaplatz Basel einen weiteren gewichtigen Player in die Schlacht gegen das Coronavirus.
Anders als Novartis, forscht Roche aber nicht an einer medikamentösen Behandlung, sondern setzt beim Testen an. Der Konzern entwickelt momentan Antikörper-Tests, mit denen untersucht werden kann, wer sich bereits mit dem Coronavirus angesteckt und dagegen Antikörper gebildet hat. Die Tests sollen Anfang Mai bereit sein (Telebasel berichtete).

Antikörper-Tests verbessern den Umgang mit dem Coronavirus, sind aber kein Allheilmittel. (Bild: x3/Pixabay)
Antikörper-Tests sind ein wichtiges Element beim Ausstieg aus der Pandemie, denn sie können die Alltagssituation für die Menschen erheblich verbessern. Wer Antikörper hat, gilt zumindest vorübergehend als immun gegen das Coronavirus und könnte ohne Gefahr wieder am öffentlichen Leben teilnehmen. Das gäbe zumindest der Wirtschaft enorm Luft. Die Lösung für das Corona-Problem sind die Antikörper-Tests aber nicht.
Impfstoff – der goldene Weg
Ein gangbarer Weg, ein Virus effizient einzudämmen, ist ein Impfstoff. Auf ihm liegen die grössten Hoffnungen der Wissenschaft, um einen Ausweg aus der Pandemie zu finden. Dementsprechend intensiv wird an der Entwicklung eines Impfstoffs geforscht. Sowohl in der Region Basel und in der Schweiz als auch weltweit.
In der Schweiz gibt es drei vielversprechende Kandidaten, die in absehbarer Zeit einen Impfstoff auf den Weg bringen könnten – einer davon kommt aus der Region.
Der Immunologe Peter Burkhard forscht mit seiner Firma Alpha O-Peptides in Riehen an einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Er klebt die sogenannten Spike-Proteine – die typischen «Stacheln» des Coronavirus – auf Nanopartikel. Diese werden dann in den Körper gespritzt und dieser bildet Antikörper gegen das Virus.
Peter Burkhard wähnte sich vor wenigen Wochen schon nahe am Ziel und spritzte sich den Impfstoff vor laufender Kamera. Er hoffte, innert weniger Wochen sagen zu können, ob sein Impfstoff wirkt oder nicht. Parallel laufende Tierversuche zeigten aber eine Verzögerung, und Burkhard kann momentan nicht sagen, wie lange sich seine Forschung noch hinziehen wird, wie SRF berichtete.
Im Kanton Freiburg versucht das Pharmaunternehmen InnoMedica, einen Impfstoff zu entwickeln. Das junge Unternehmen rüstet Liposome mit den Spike-Proteinen des Coronavirus auf. Im menschlichen Körper drin, bildet dieser dann Antikörper gegen diese gepimpten «Fettzellen», so die Hoffnung.
Die Forschung ist auf einem guten Weg: 98 Prozent des Impfstoffs sind entworfen, wie Stéfan Halbherr, Leiter Forschung und Entwicklung, jüngst gegenüber SRF erklärte.

Für das Coronavirus typisch sind die Spike-Proteine – eine Art «Stacheln» an der Oberfläche. (Bild: Daniel Roberts/Pixabay)
Am Berner Inselspital forscht Martin Bachmann von der Universität Bern an der goldenen Lösung: Er machte kürzlich die äusserst ambitionierte Aussage, dass der Schweiz bereits im Oktober ein Impfstoff zur Verfügung stehen könnte.
Bachmann nimmt Teile des Coronavirus und setzt sie auf ein Virus, das ursprünglich einmal auf Gurken gelebt hat. Tierversuche mit dem Impfstoff waren bereits erfolgreich. Der Körper erkennt das Virus als solches. Nun müsse man noch erproben, ob der Erreger auch bekämpft werde, so Bachmann gegenüber SRF.
International tüfteln ebenfalls viele Forschungseinrichtungen in ihren jeweiligen Ländern nach einem Impfstoff. Der Wettbewerb läuft auf Hochtouren.
Die internationale Impfstoff-Allianz CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) ist eine koordinierte Stelle zwischen Regierungen, Organisationen wie der WHO und Forschungseinrichtungen und kämpft ebenfalls um einen Impfstoff. Einer ihrer Mitbegründer ist Microsoft-Urheber Bill Gates, der jüngst in einem Gastbeitrag für die «Welt am Sonntag» erklärte, die CEPI arbeite an mindestens acht möglichen Impfstoffen. Wissenschaftler würden davon ausgehen, dass in rund 18 Monaten ein Serum anwendungsbereit sei.
Immer wieder wird dieser Tage von Forschern die Hoffnung in den Raum gestellt, dass ein Impfstoff gegen Corona in 12 bis 18 Monaten bereit stehe.
Roche-CEO Severin Schwan verdunkelte dieses Licht am Horizont am Mittwoch mit seiner Aussage: «Ich persönlich finde den geplanten Zeitrahmen von 12 bis 18 Monaten angesichts der Herausforderungen ehrgeizig». Viel mehr als Spekulationen und persönliche Vermutungen über einen Impfstart sind zurzeit aber auch nicht möglich. Denn ein Impfstoff muss nicht nur die Hürden der strengen Tests im Labor überwinden.
Türöffner sind die Politik – und das Geld
Wer einen Impfstoff auf den Markt bringen will, braucht auch das Geld auf seiner Seite. Denn die entscheidenden Tests kosten viel, für die spätere Herstellung braucht es ebenso viele Mittel. Auf finanzielle Hilfe des Bundes sind in der Schweiz ziemlich alle Kandidaten für einen Corona-Impfstoff angewiesen.
Momentan verhandelt der Bund darüber, ob er privaten Firmen für die Entwicklung Geld beisteuern soll. Den finanziellen Gewinn würden am Ende die Unternehmen einstreichen, der Bund würde die Gesundheit der Bevölkerung sichern. Das grosse Plus für Bundesbern: Es könnte bei einem Deal mit einem nationalen Entwickler einfordern, dass die Schweizer Bevölkerung zuerst geimpft wird.
Genauso wichtig wie die finanziellen Mittel ist für die Entwickler eines Impfstoffs die politische Unterstützung. Auch hier ist wieder der Bund gefragt. Er soll dafür sorgen, dass Tests schnell vollzogen und Bewilligungen rasch erteilt werden können, damit ein Impfstoff gegen Corona bestenfalls innerhalb von Monaten auf den Markt kommt. Normalerweise dauert ein solcher Prozess fünf bis zehn Jahre.
Was passiert, wenn das Virus mutiert?
An all diesen Schrauben drehen Forschung, Wirtschaft und Politik zurzeit fleissig, damit sich das Rad der Entwicklung möglichst rasch dreht. Denn es geht nach wie vor um viele Menschenleben rund um den Globus.
Die bisherigen Versuche und Erfahrungen in der Corona-Pandemie zeigen: Der Ausweg führt nur über einen Impfstoff oder ein Medikament, das präventiv oder zur Behandlung von Infektionen eingenommen werden kann. Erst dann verliere das Coronavirus «seinen Schrecken», wie der Vizepräsident des renommierten Robert-Koch-Instituts in Deutschland, Lars Schaade, sagte. Zumindest vorläufig.
Zur Natur der Viren gehört, dass sie mutieren. Dadurch erhalten sie neue Eigenschaften und entwickeln sich weiter. Es kann also sein, dass ein Impfstoff oder ein Medikament kein endgültiger Siegeszug über Corona ist, sondern nur ein vorübergehender Erfolg.

Der goldene Weg aus der Pandemie oder nur ein zwischenzeitliches Durchatmen? Was ein Impfstoff gegen das Coronavirus tatsächlich für einen Erfolg bringt, kann nicht eindeutig vorausgesagt werden. (Bild: Willfried Wende/Pixabay)
Das Coronavirus ist in der Vergangenheit bereits mutiert. Aber es mutiert langsamer als zum Beispiel Grippeviren, wie der Virologe Martin Stürmer gegenüber dem ZDF erklärte: Nach bisherigem Wissensstand müsse man «nicht unbedingt davon ausgehen, dass man jedes Jahr einen neuen Impfstoff braucht wie bei der Influenza». Das sei die Hoffnung für die nächsten Jahre.
Ein Impfstoff gegen Corona birgt also die Chance, gleich für eine längere Zeit als bloss eine Saison lang wirksam zu sein. Eine Erlösung auf Zeit. Da sich das Coronavirus aber weiter entwickeln wird, wird es auch in ferner Zukunft heissen: dranbleiben.
Erschienen am 23. April 2020 auf telebasel.ch.
Wenn nicht anders deklariert, sind die Inhalte Eigentum von Telebasel. Sämtliche Inhalte werden nicht zu kommerziellen Zwecken genutzt.